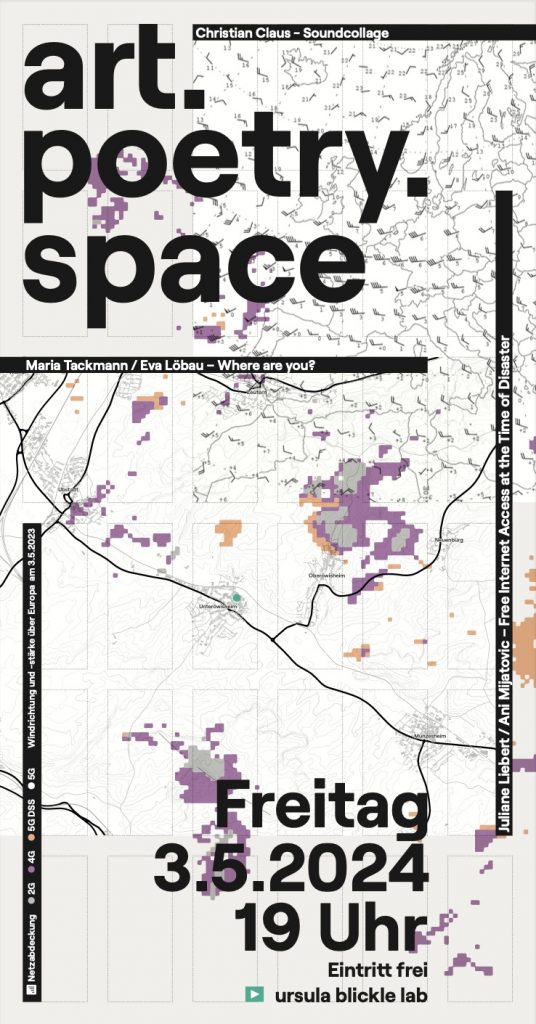Ursula Blickle und das Team der Ursula Blickle Stiftung trauern um Peter Weibel.
Peter Weibel (1944-2023) war seit 1999 Direktor des ZKM – Zentrum für Kunst und Medien – in Karlsruhe. Unter seiner Leitung, die ein Vierteljahrhundert währte, gelangte das ZKM auf die Liste der zehn wichtigsten kulturellen Einrichtungen, die die New York Times in einem weltweiten Ranking ermittelt. Doch Peter Weibel brauchte keine Institution. Er war selbst eine. Über den Ideengeber, den Vordenker und Theoretiker, über den Aktions-Künstler, Avantgardisten, Musiker und Performer ist in den Tagen seit seinem Tod am 1. März dieses Jahres mit Recht viel geschrieben worden. Angefangen hat Peter Weibel indes als Dichter.
Anlässlich eines Vortrags, den er im Jahre 2013 vor Studierenden der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe gehalten hat, präsentierte er handschriftliche Aufzeichnungen mit ersten poetischen Arbeiten des 22jährigen Wiener Studenten. Diese Blätter ähnelten schon damals eher Schaltplänen als mit Textzeilen gefüllten Manuskriptseiten. An poetische Intuition glaubte Peter Weibel nicht, sein Blick auf Schrift und Sprache war von Abstraktion und Analyse getrieben. So legte er auf den Spuren von Jean Starobinski oder Ferdinand de Saussure „Wörter unter Wörtern“ frei und präparierte zum Beispiel in dem Wort TEENAGER das Wort EAGER heraus, alles noch auf einer Papierseite im zweidimensionalen Medium Schrift. Schon zwei Jahre später folgten Begriffsskulpturen, in denen er mithilfe von Neon-Schaltungen in der Buchstabenfolge ABFAELLE die Worte BALL, FALL, ALL oder ALLE aufblitzen ließ. Weibel, der seine Installationen Motion Poems nannte, interessierte sich für die verschiedenen Lesarten und Bedeutungen von Buchstabenkonstellationen. Dabei genügte es ihm aber nicht, Sprache auf Syntax und Semantik zu reduzieren. Er wollte die jeweiligen Medien einbeziehen und seine Sprach-Installationen an die Funktion der technischen Geräte rückbinden. Auch eine Schreibmaschine, von der wir seit Nietzsche wissen, dass sie als technisches Medium an unseren Gedanken mitschreibt, taucht in seinen frühen Arbeiten auf. Als der eingespannte Bogen unter Feuer gesetzt wird, brennt nicht nur das Papier, sondern auch am Korpus der Maschine nagen die Flammen. Materialität und Medialität sind von Beginn an sein Thema.
Auch in einer anderen Arbeit dieser frühen Jahre steht eine Schreibmaschine im Fokus. Hier reicht es dem Künstler nicht, die Schrift als Produktions- oder Speichermedium zu befragen, nun rückt er die Gewalt, die von Sprache und Schrift ausgehen kann, in den Mittelpunkt. Dabei wandert, wie es in einem späteren Ausstellungstext zu der Installation von 1971 heißt, die „Erfahrung des Widerstandes und des Schmerzes vom reinen Reich der Zeichen (Buchstaben) auf die Materialität der Tastatur, die mit Reißnägeln versehen ist. “Der Schmerz ist nun physisch präsent und nicht „nur“ in einem Text repräsentiert. Dass man in der Aktions-Kunst nicht symbolisch handeln kann, sondern mit dem eigenen Körper einstehen muss, hatte er schon gezeigt, als er sich ebenfalls in dieser frühen Werkphase ein Gedicht in die Haut seines Armes einnähen ließ. Die radikalste Aktion aber fällt in das Jahr 1973. Peter Weibel beschreibt das Szenario als „Skulptur mit angeschlossenem lebenden Organismus“. Bei der Skulptur handelte es sich um einen Steinklotz, bei dem lebenden Organismus um den Künstler, der den Klotz mit seinen Armen umfasst. Über Stunden hatte er seine Zunge dort einbetoniert, um die Gewalt der Sprache physisch spürbar zu machen. Sprache ist nicht unschuldig, sie entscheidet über Sinn und Unsinn, über Haben und Nicht-Haben, über Sein und Nicht-Sein. Raum als Sprache lautet fast lapidar der Titel dieser Aktion.
Wer Peter Weibel zuhörte, erlebte ihn nicht nur als einen mit allen linguistischen Wassern gewaschenen Sprachkünstler, der die Macht der Sprache, deren Potential und deren Grenzen in alle möglichen Richtungen herausforderte, sondern auch als einen äußerst eloquenten Gesprächspartner und Vortragenden. Kleists „allmähliches Verfertigen der Gedanken beim Reden“ machte er sich allerdings ebenso wenig zu eigen wie einen Satz aus Susan Sontags Tagebuch: „Wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage.“ Denn der Prozess des zur-Sprache-Bringens dauerte ihm viel zu lang. Soviel Zeit hatte Peter Weibel nicht.
Als Theoretiker, der zeit seines Lebens der Erforschung menschlicher Kommunikation auf der Spur war, wusste er nur zu gut: Denken geht schneller als Sprechen. Bis das Synapsengewitter auf der Zunge ankommt, braut sich längst schon an anderer Stelle eine neue Assoziations-Front zusammen. Um den umständlichen Weg der Sprache, die über Sprechwerkzeuge wie Kehlkopf oder Zunge und den Echoraum der Mundhöhle zur Artikulation finden muss, abzukürzen, entwickelte er einen rhetorischen Stenogrammstil. Er sprach nicht im Parlando, sondern intonierte seine Worte und Satzkaskaden in einem Stakkato-Rhythmus. Dabei ertränkte er ungeniert ganze Silben in seinem Wiener Sprachfluss. Am Ende blieb eine Art Slam-Sprech übrig, bei dem man als Zuhörer eine Weile brauchte, um herauszufinden, was er da gerade sagte – ja, ob er deutsch oder englisch sprach. Dominant war einzig der Basso continuo seines Wiener Idioms. Peter Weibels Sprachduktus verlangte seinem Publikum durchaus einen gewissen Grad an Kombinationsfähigkeiten ab. Einer poetischen Lesart blieb seine Rede indes immer zugänglich. „Genuine poetry can communicate before it is understood“, wissen wir mit T.S. Eliot. In diesem Sinne ist Peter Weibel immer ein Poet geblieben.
Was also soll einer machen, dem die Geistesblitze schneller auf der Zunge einschlagen, als sie sich in artikulierte Laute verwandeln können. Das ist kein kognitives Problem, sondern ein physiologisches. Die Sprache ist zu langsam, um das Einprasseln von Gedanken, Gefühlen, Ideen, Assoziationen und Beobachtungen 1 : 1 abbilden können. Ein Dichter wie Rolf Dieter Brinkmann, der ein Geistesverwandter von Peter Weibel war, hat dieses Manko an Gleichzeitigkeit durch audiovisuelle Medien einzuholen versucht, nachdem er seine Gedichte in Plastik eingeschweißt und in einer Truhe versenkt hatte. Fortan wollte er nur noch mit Bild und Ton arbeiten. Als Brinkmann 1975 in London starb, hatte auch Peter Weibel seine Buchpläne begraben und experimentierte mit Film und Video. Peter Weibel hat Rolf Dieter Brinkmann um 48 Jahre überlebt. Mehr Zeit hat er also gehabt. Doch diese Form von Gleichzeitigkeit, nach der sie beide suchten, bleibt bis heute ein Manko in unserer physischen Grundausstattung, das sich auch medial nur unzureichend überbrücken lässt. „Gegenwart – wann war das?“ lautet eine Gedichtzeile von Thomas Brasch.
Dr. Stephan Krass ist Kurator des ursula blickle lab und Honorarprofessor für literarische Kunst an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe.